Forschungsprojekte der DHBW Heidenheim
EU4Dual: Die DHBW ist European University
EU4Dual ist eine europäische Hochschulallianz – der einzige Verbund dualer Hochschulen innerhalb der Europäischen Union. Ziel der Allianz ist es, Qualitätsstandards für das duale Studium in der EU festzulegen. Als weltweite Referenz für qualitativ hochwertige duale Studienangebote soll EU4Dual das duale Studium verbreiten und den internationalen Austausch intensivieren.
Gemeinsam mit acht weiteren europäischen Hochschulen hat sich die Duale Hochschule Baden-Württemberg außerdem folgende Ziele gesetzt:
- Studierendenmobilität
- Lehrendenmobilität
- Mitarbeitendenmobilität
- Gemeinsame Lehr- und Forschungsprojekte
Project website (English)
Projektseite (Deutsch)
Learner Centric Advanced Manufacturing Platform for CoVEs (LCAMP, ERASMUS+)
The fifth industrial revolution is built upon the technologies of the fourth, with an increased emphasis on a human-centric, sustainable, and resilient industrial base, emphasising the digital and green transitions. A key pillar of this economic transformation is the role played by Advanced Manufacturing systems such as Robotics, 3D & 4D printing, artificial intelligence, and high-performance computing. I5.0, requires VET to develop 'learning centric approaches' that focus on the holistic competences of humans that plan, manage, oversee, or operate technologies. LCAMP will tackle this by incorporating a permanent European Platform of Vocational Excellence for Advanced Manufacturing, seeded from a consortium of 20 partners and over 50 associate organisations including leading VET/HVET centres, companies, regional government, R&D centres, associations of companies and clusters. By collaborating across borders, LCAMP’s goal is to support and empower regional AM CoVEs to become more resilient, innovative, and better equipped to train, upskill, and reskill young and adult students to successfully face the digital and green transitions. We will help regions grow and be more competitive through their VET systems. The Alliance is service-oriented, planning to establish permanent structures for: Teaching & Learning: establishing AM skills frameworks and curricula; launching or revising AM programmes (including micro-credentials); creating or capacity building learning factories (special AM labs, jointly run by VET and industry) Cooperation and Partnerships: launching a skills & jobs observatory for advanced manufacturing; accelerating industry/VET/region cooperation ideas via an open innovation community and providing consultancy to SMEs on integrating SME/VET connections. Governance & Funding: creating a one-stop-shop portal for all our services; ensuring a business case for continuing services to stakeholders in the long-term, while enhancing participation.
Contact: Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Rupp
Laufzeit: September 2022 bis Juli 2025


EdCoN (Stiftung Innovation in der Hochschullehre)
Die DHBW startet zum 1. August 2021 ein innovatives Education Competence Network, um nachhaltige, strategisch ausgerichtete und standortübergreifende Lehr- und Lernangebote zu entwickeln, die innerhalb aller DHBW-Standorte genutzt werden. An jedem Standort gibt es ein Lehr-Lern-Labor (= Education Competence Center-ECC), das sich mit verschiedenen digitalen und didaktischen Innovationsthemen beschäftigt. Am Standort Heidenheim liegt der Schwerpunkt auf dem Thema „Lernortkooperation entlang des Virtuality Continuum“. Ziel des Heidenheimer ECC ist es, neue Wege zur Nutzung von Lehrtechnologie, basierend auf Augmented Reality, Mixed und Virtual Reality zur Verbindung der DHBW-Lernorte wie DHBW-Standorte, Partnerhochschulen und Duale Partner zu entwickeln, zu testen und im Hochschulbetrieb anzuwenden.
Kontakt: Prof. Dr. Sabine Möbs
Projektseite
AuReLia-Labor
Forschungsposter I
Forschungsposter II

FIRE-Netzwerk
Das Forscherinnen-Netzwerk FIRE (Female International Research Network @DHBW) konsolidiert existierende Kontakte und macht durch den strukturierten Austausch die Forschungskompetenzen und –Ressourcen der DHBW und der afrikanischen Partnerhochschulen auch für kooperative Forschung nutzbar. Das Netzwerk hat im Jahr 2021 zwei erfolgreiche Projektanträge eingereicht, FIRE@DHBW und FIRE Talk.
Kontakt: Prof. Dr. Sabine Möbs
FIRETalk (Baden-Württemberg-Stipendium für Studierende BWS-plus)
FIRE Talk offers solutions for:
- the inadequate attention given to researchers and research activities in university internationalization strategies
- the high supervision loads and lack of access to praxis-oriented research topics (for African partners) and the need for PhD-awarding partner universities (for DHBW)
- the general lack of recognition and promotion of female researchers
FIRE Talk focuses on online trainings for transversal research skills using innovative formats such as "Research Students on FIRE!-BarCamp" or "Modern Science Communication". This is complemented by face-to-face meetings that aim to connect research support, international offices and dual partners.
Contact: Prof. Dr. Sabine Moebs
FIRE@DHBW (DHBW-Stiftung)
Der gemeinsame Ansatz zur Stärkung und Etablierung der Zusammenarbeit wird ermöglicht durch die drei Aktionsfelder dieses Projektantrags:
A) FIRE-Internationalisierungsplattform als Intranet für Duale Partner, afrikanische und DHBW-Professorinnen und weitere Forscherinnen der beteiligten Hochschulen
B) Eine jährliche internationale FIRE@DHBW-Forschungskonferenz, abwechselnd in Präsenz und als innovatives Online-BarCamp Mixed Method Research
C) Trainings für Transversale Skills, die auch Online durchgeführt werden können, zum Aufbau von Kompetenzen für eine erfolgreiche Karriere und Karriereplanung in Wissenschaft und Forschung
Kontakt: Prof. Dr. Sabine Möbs
AAL InnoZ
Das AAL InnoZ ist ein Netzwerk, das den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis sowie der Gesellschaft zum Thema Active Assisted Living (AAL) fördert. Das Active Assisted Living Lab, das aktuell an der DHBW Heidenheim eingerichtet wird, dient der fachübergreifenden Forschung, Entwicklung und Vernetzung an der Schnittstelle von Pflegewissenschaft, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Technik (insbesondere Informatik) und Wirtschaft.
Ziel ist es bereits bestehende Lösungen in Zusammenarbeit mit Spezialisten verschiedener Gesundheitsprofessionen weiterzuentwickeln. Ebenso sollen neue Prozesse, Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen herausgearbeitet werden.
Kontakt: Dr. Mirjam Folger
Zur Projekt-Seite
Forschungsposter
Evaluation simulationsbasierter Lehr- und Lernsituationen im Studiengang Angewandte Hebammenwissenschaft
Durch die Akademisierung und gesetzlichen Vorgaben zur Simulation in der staatlichen Prüfung steht die Hebammenlehre vor neue Herausforderungen. Wissenschaftliche Untersuchungen, inwiefern die Kompetenzen der Hebammenkunde tatsächlich in Laborszenarien entwickelt werden können, liegen derzeit nicht vor. Ferner liegen keine Ergebnisse vor, welche Fertigkeiten, Problemlösungskompetenzen und klinische Entscheidungsfindungen erfolgreich in Simulationen der Hebammenkunde gelehrt und erlernt werden können.
Kontakt: Christina Oberle und Prof. Dr. Marcel Sailer
Zur Projekt-Seite
Forschungsposter I
Forschungsposter II
Forschungsposter III
Forschungsposter IV
Forschungsprojekt zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe
Die Forschenden fokussieren den Kinderschutz für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, weil Studien zeigen, dass diese eine besonders vulnerable Gruppe darstellen. Ziel des Forschungsprojekts ist es, durch die Untersuchung von Kinderschutzfällen neue Erkenntnisse zu gewinnen, um die Kinder- und Jugendhilfe in Baden-Württemberg inklusiver und effektiver zu gestalten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der verbesserten Sichtbarkeit von Kindern mit Behinderungen im Kinderschutz sowie auf der Förderung einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen der Eingliederungs- und Jugendhilfe.
Das Projekt verfolgt ein partizipatives Forschungsdesign, das eine aktive Einbindung von Fachkräften und Betroffenen ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass praxisnahe und relevante Ergebnisse erarbeitet werden, die die Bedürfnisse der betroffenen Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen. Neben den Erfahrungen in Ulm werden auch Fälle anderer Kommunen aus Baden-Württemberg in die Untersuchung einbezogen.
Das zweijährige Forschungsprojekt zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe wird von Prof. Dr. Anja Teubert (DHBW Stuttgart) und Prof. Dr. Bärbel Amerein (DHBW Heidenheim) geleitet. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt mit Simone Fischer, der Beauftragten des Landes Baden-Württemberg für die Belange von Menschen mit Behinderungen.
Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit Valerie Frese von der Stadt Ulm und Wissenschaftler*innen der DHBW durchgeführt. Neben den genannten Personen arbeiten Julia Huber und Milena Buhl von der DHBW Stuttgart im Forschungsteam. Unterstützt wird das Team von Prof. Dr. Thomas Meyer (DHBW Stuttgart) und Prof. Dr. Frank Birk (DHBW Villingen-Schwenningen) sowie von Dr. Katrin Heeskens von der Fakultät Wirtschaft und Gesundheit an der DHBW Stuttgart.
Weitere Informationen zum Projektverlauf und den Ergebnissen werden im Laufe der nächsten zwei Jahre veröffentlicht. Eine Projektseite befindet sich im Aufbau.
Religion und säkulare Gesellschaft: Eine qualitative Studie zur Bedeutung von Gottesbildern und Wahrnehmung sakraler Symbolik für die Entstehung gruppenbezogener Stereotype und Vorurteile
In jüngster Zeit wird die Integrationsfähigkeit europäischer Demokratien zunehmend durch (rechts-)populistische Strömungen herausgefordert, die gezielt Zuschreibungen kultureller und religiöser Fremdheit zur Ausgrenzung von Fremdgruppen benutzen. Derzeit fehlt es jedoch an einem angemessenen Verständnis für die Wirkfaktoren, die die populistische Mobilisierbarkeit der Mehrheitsgesellschaft durch identitätsstiftende Konzepte eines „christlichen Abendlandes“ erklären können. Religionssoziologisch wird dabei die Rolle von den in der Mehrheitsgesellschaft vorhandenen subjektiven Gottesbildern bei der religiösen Identitätsbildung und Fremdgruppendefinition zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ein besseres Verständnis des Zusammenhangs zwischen persönlichem Gottesbild bzw. religiöser Identität in der christlich geprägten Majoritätsgruppe und der Wahrnehmung ‚fremdreligiöser‘ Sakralarchitektur kann künftig Beiträge zur verbesserten interreligiösen Kommunikation – etwa in Gestaltung interreligiöser Begegnungszentren in den ethnisch und kulturell stark gemischten Stadtvierteln Heidenheims und andernorts – begründen.
Kontakt: Georg Reiff und Prof. Dr. René Gründer
Die unbefugte Weitergabe von Sexting-Dateien unter Jugendlichen als ein Phänomen der digitalen Transformation von Gesellschaft. Hintergründe, Sanktionierung, Prävention
Der erotische Bildnachrichtenaustausch via Smartphone hat sich durch die rasante Entwicklung digitaler Kommunikationsgeräte mittlerweile als nicht unübliche Praxis im Jugendalter etabliert: das sogenannte Sexting. Obschon Sexting unter Jugendlichen durchaus positive Zwecke erfüllt, geht doch eine wesentliche Gefahr vom Austausch erotischer, freizügiger, bisweilen auch jugendpornografischer Bilder und Videos aus: die unbefugte Weitergabe der Sexting-Dateien an Dritte. Werden die im Vertrauen versendeten Bild- oder Videodateien weitergeleitet, hat dies nicht nur (zum Teil massive) Folgen für die Betroffenen. Auch die Täter*innen erleben Konsequenzen. Bei dieser Personengruppe setzt die Forschung an: Was treibt Jugendliche an, Sexting-Dateien anderer Personen weiterzuleiten? Welche Art der Sanktionierung erfahren sie und wie kann die Soziale Arbeit „richtig“ reagieren?
Kontakt: Tanja Wind und Prof. Dr. Jürgen Burmeister
Die Arbeitsmarktintegration rumänischer Zuwanderer*innen seit der Öffnung des deutschen Arbeitsmarkts für rumänische Bürger*innen am Beispiel Heidenheim
Migrant*innen aus Rumänien stellten im Jahr 2019 die größte Gruppe neuzugewanderter Personen in Deutschland. Diese Entwicklung lässt sich - seit der Öffnung des Arbeitsmarktes für Rumänien 2014 - auch in Heidenheim erkennen. Diese Arbeitsmarktintegration rumänischer Zugewanderter wurde bisher insbesondere im ländlichen Raum kaum wissenschaftlich untersucht. Diese Dissertation soll dazu beitragen die Situation der zugewanderten Personen aus Rumänien in Heidenheim näher zu analysieren.
Kontakt: Léa Bendele und Prof. Dr. Andrea Helmer-Denzel
Modellierung und Simulation der Ausscheidungskinetik mikrolegierter Kupferbasislegierungen
Kupferlegierungen weisen eine sehr gute Leitfähigkeit für elektrischen Strom und Wärme auf, während aus Sicht der mechanischen Festigkeit nach wie vor Optimierungspotential vorhanden ist. Die Dissertation untersucht den Einsatz von geringen Zusätzen von Legierungselementen, welche einerseits das Material verfestigen und andererseits den durch die Festigkeitssteigerung einhergehenden Abfall der Leitfähigkeit minimieren. Dieser Zielkonflikt soll über eine optimierte Gestaltung des Werkstoffgefüges realisiert werden, welches unter anderem durch verschiedene thermomechanische Behandlungsmethoden beeinflusst wird.
Kontakt: Ramona Lucy Henle und Prof. Dr. Gerrit Nandi
Qualitätsmanagementsystem für PEM Brennstoffzellen
In diesem Forschungsvorhaben werden ausschließlich Proton Exchange Membrane Brennstoffzellen (PEMFC) untersucht. In Kooperation mit der DHBW Mannheim und der Arvos Ljungström GmbH wird ein innovatives Kühlsystem für PEMFCs entwickelt, um eine möglichst homogene Temperaturverteilung über die PEM zu gewehrleisten. Aufgabe der DHBW Heidenheim ist es, mittels industrieller Röntgencomputertomographie und der Rasterelektronenmikroskopie einen Qualifizierungsprozess des Kühlsystems zu entwickeln, um dieses zu validieren und die prozesssichere Fertigung zu gewährleisten. Ziel ist hierbei die Gesamtkosten des Betriebs von PEMFCs zu reduzieren und die Großserienanwendung zu ermöglichen.
Kontakt: Stephan Stötter und Prof. Dr.-Ing. Nico Blessing
Emerging Risks and Finance – Developing Risk-Return Management Techniques
Research on “Emerging Risks and Finance” involves the analysis and modeling of challenges related to ecology, society, technology, and economy from a monetary perspective. It explores approaches to operationalize upcoming threats and opportunities for financial assets, institutions, and markets. Research on emerging risks further provides the basis for the development of appropriate risk-return management techniques in finance and beyond as well as their feedbacks on the overall system.
Kontakt: Prof. Dr. Dieter Gramlich
Technologische Entwicklungen von Augmented Reality und deren Einsatz zur Förderung der Lernortkooperation im dualen Studium
Dieses Forschungsvorhaben steht im Zusammenhang zum Projekt „Education Competence Network (EdCoN)“ und zielt auf die Einbindung von Augmented Reality (AR) als Lerntechnologie im dualen Studium. Hierzu werden Anwendungsszenarien in verschiedenen Studiengängen unter Berücksichtigung der technologischen Entwicklung von AR erhoben, umgesetzt und evaluiert. Insbesondere die Umsetzung der AR-basierten Lernszenarien soll die Zusammenarbeit zwischen den Standorten der DHBW, den Partnerhochschulen /-universitäten sowie dualen Partnern erfolgen, um somit die Lernortkooperation zu stärken.
Kontakt: Prof. Dr. Sabine Möbs
AuReLia-Labor
Forschungsposter
An Accessible Open-Source Augmented Reality Learning Authoring Platform for Engineering and Sciences
Augmented Reality (AR) is a technology that superimposes the real-world objects with virtual generated information in the same space, thus providing a more useful composite view. AR is becoming a very popular learning technology as it creates an immersive hybrid learning environment that facilitates critical thinking, problem-solving and communicating through interdependent collaboration exercises. Studies show that most AR applications are being developed by using proprietary Software Development Kits (SDK) which have heavy substantial annual licence fees and thus becoming an obstacle for many small to mid-sized companies as well as lower and higher learning institutions. Developing these learning applications using existing SDK requires technical knowledge such as programming which, according to many studies, lacks among many teachers. This research, therefore, wants to develop an accessible open-source AR learning authoring platform that will enable lecturers with little technical knowledge to author learning applications for their students.
Contact: Deogratias Shidende and Prof. Dr. Sabine Moebs
Digitalisierungs-Circle
Das Thema Digitalisierung in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft prägt bereits seit einiger Zeit die Forschungsaktivitäten im Studiengang BWL - Versicherung. Dieses Engagement wird zukünftig noch erheblich ausweiten. Dabei soll Digitalisierung nicht nur von der technischen Seite aus betrachtet werden, sondern vielmehr vor allem auch unter Management-Gesichtspunkten.
Hierfür wurde der Digitalisierungs-Circle des Studiengangs BWL - Versicherung ins Leben gerufen.
Kontakt: Prof. Dr. Jürgen Hilp I Studiengang: BWL - Versicherung
DIKOMED BW – Digitalkompetenz für medizinische Leistungserbringer
Das Forschungsprojekt DIKOMED BW fokussiert die DigitalKompetenz bei Medizinischen Leistungserbringern, insbesondere bei Ärzteschaft und Pflege in Baden-Württemberg. Gefördert durch das Land Baden-Württemberg aus dem Europäischen Sozialfond im Rahmen des Programms REACT-EU, E 1.1.3 Digitale Befähigung in Medizin und Akutpflege. Konsortialführer: Prof. Dr. Oliver G. Opitz, Leiter der Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg (KTBW). Die Forschungsgruppe an der DHBW Heidenheim unter der Leitung von Prof. Dr. Barbara Steiner & Prof. Dr. Marcel Sailer entwickelt dabei Digital Health & Education Trainings mit den Zielgruppen akademischer und nichtakademischer Pflegekräfte sowie Gesundheitssozialarbeiter*innen in der Anwendung technologischer Unterstützungssysteme (AAL Technologien) in der Gesundheitsversorgung. Das interprofessionell angelegte Projekt ist über das Innovationszentrum AAL InnoZ an die Hochschule angebunden.
Kontakt: Prof. Dr. Barbara Steiner, Prof. Dr. Marcel Sailer
Zur Projekt-Seite
Forschungsposter
EXAM 4.0 - EXCELLENT ADVANCED MANUFACTURING 4.0
EXAM 4.0 ist ein europäisches Forschungsprojekt, das in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteur*innen aus dem VET-(Vocational education and training), HVET-Sektor (higher VET) und weiteren Partner*innen des Industriesektors die Anforderungen und Bedarfe der Wirtschaft identifizieren und definieren will. Das Ziel von EXAM 4.0 ist es, Vertreter*innen von VET/HVETs, Unternehmen, politische Entscheidungsträger*innen und Individuen zusammenzubringen, um europäisch-regionale Qualifikationsökosysteme zu schaffen und Labore aufzubauen, in denen Lernende relevante Kompetenzen für die Arbeit in der Industrie 4.0 erwerben können.
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Rupp
Zur Projekt-Seite

PfAU – Neue Pfade in Ausbildungsberufen der Pflegehilfe in Ulm
Dem durch die demographische Entwicklung bedingten steigenden Bedarf an Fachkräften in den Pflegeberufen steht eine sinkende Zahl von Absolvent/-innen in diesem Bereich gegenüber. Für das Jahr 2030 wird für die Altenpflege ein Engpass von ca. 180.000 Arbeitskräften prognostiziert, für die Gesundheits- und Krankenpflege ein Engpass von ca. 300.000 Arbeitskräften.
Zur Fachkräftesicherung im Großraum Ulm werden interessierte junge Menschen mit Unterstützungsbedarf (z. B. Personen mit Lernbeeinträchtigung, Migrationshintergrund) in einer zweimonatigen Vorbereitungsphase bei der Aufnahme und zwölf Monate begleitend beim Absolvieren einer Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe bzw. der Altenpflegehilfe an der Fachschule der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm unterstützt. Evaluiert wird das Projekt durch die DHBW.
Studiengang: Soziale Arbeit - Soziale Arbeit mit älteren Menschen/Bürgerschaftliches Engagement
Studiengang: Interprofessionelle Gesundheitsversorgung
Ansprechpersonen: Prof. Dr. Andrea Helmer-Denzel und Prof. Dr. Claudia Winkelmann
Zum Forschungsposter
Publikationen
- Winkelmann C./Helmer-Denzel A. (2019) PfAU: Neue Wege zum Lückenschluss. In: Pflegezeitschrift, December 2019, Volume 72, Issue 12, pp 56–58. Online-ISSN 2520-1816. https://link.springer.com/article/10.1007/s41906-019-0191-3

Öffentliche Wissensressourcen (ÖWR)
ÖWR steht für Offene WissensRessourcen in der öffentlichen Verwaltung: Training, Kompetenz und Sensibilisierung. Im Projekt ÖWR geht es um Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung der Öffentlichen Verwaltung in Deutschland in Bezug auf offene Lern- und Wissensressourcen. Dabei setzt das Projekt Impulse zur Nutzung von Open Educational Resources (OER).
Studiengang: Wirtschaftsinformatik I Laufzeit: November 2016 - April 2018 I Ansprechpartnerin: Prof. Dr. Sabine Möbs
Zur Projekt-Seite
Zum Forschungsposter

Das EAGLE-Projekt
Die Flut an Vorschriften nimmt ständig zu und die Regelungen werden immer komplexer. Es dauert zu lange, bis Zugang zu relevanten Informationen in verständlicher Form geschaffen werden können. Das EAGLE (EnhAnced Government LEarning)-Projekt ist ein von der EU gefördertes Projekt zur Schaffung einer ganzheitlichen Lernlösung für die öffentliche Verwaltung.
Studiengang: Wirtschaftsinformatik I Budget: 3,2 Mio Euro I Laufzeit: Februar 2014 - Januar 2017 I Ansprechpartnerin: Prof. Dr. Sabine Möbs
DIKOMED BW – Digitalkompetenz für medizinische Leistungserbringer
Das Forschungsprojekt DIKOMED BW fokussiert die DigitalKompetenz bei Medizinischen Leistungserbringern, insbesondere bei Ärzteschaft und Pflege in Baden-Württemberg. Gefördert durch das Land Baden-Württemberg aus dem Europäischen Sozialfond im Rahmen des Programms REACT-EU, E 1.1.3 Digitale Befähigung in Medizin und Akutpflege. Konsortialführer: Prof. Dr. Oliver G. Opitz, Leiter der Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg (KTBW). Die Forschungsgruppe an der DHBW Heidenheim unter der Leitung von Prof. Dr. Barbara Steiner & Prof. Dr. Marcel Sailer entwickelt dabei Digital Health & Education Trainings mit den Zielgruppen akademischer und nichtakademischer Pflegekräfte sowie Gesundheitssozialarbeiter*innen in der Anwendung technologischer Unterstützungssysteme (AAL Technologien) in der Gesundheitsversorgung. Das interprofessionell angelegte Projekt ist über das Innovationszentrum AAL InnoZ an die Hochschule angebunden.
Kontakt: Prof. Dr. Barbara Steiner, Prof. Dr. Marcel Sailer
Zur Projekt-Seite
Forschungsposter
Rollenveränderungen durch die Akademisierung der Pflege- und Gesundheitsberufe
In den letzten Jahren wurden in Deutschland Studiengänge zur direkten Patientenversorgung eingerichtet. Während in der Praxis das Aufgabengebiet künftiger Absolventen derzeit nicht hinreichend geklärt ist, ist gerade die spezifische Betreuung während der Praxisphase für die Zielerreichung elementar. Daraus leitet sich die Frage nachder beruflichen Sozialisation der Studierenden im Kontext der sich verändernden Rolle im Praxisalltag ab.
Studiengang: Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften I Ansprechpartner: Prof. Dr. Marcel Sailer
eCampus Public Health- Virtual Concept
Das eCampus-Projekt fördert die virtuelle, standortübergreifenden Lehre. Das Teilprojekt „Public Health- Virtual Concept“ beinhaltet ein Blended-Learning-Konzept zur Vermittlung essenzieller Themen aus dem Bereich Public Health. In diesem Pilotprojekt waren die Standorte Heidenheim und Stuttgart vernetzt.
Studiengang: Interprofessionelle Gesundheitsversorgung I Ansprechpartnerin: Prof. Dr. Claudia Winkelmann
Lernen in der praktischen Ausbildung – Mentoren-Qualifizierung in den Praxiseinrichtungen
Wesentliche Voraussetzung für die adäquate Ausbildung am Lernort Praxis ist das fachlich und pädagogisch qualifizierte Personal. In der Pflege ist hierfür die Praxisanleitung vom Gesetzgeber vorgeschrieben und etabliert. Für Therapieberufe ist dieses Konzept weder gesetzlich verankert, noch im Budget der Praxen und Kliniken berücksichtigt oder direkt übertragbar. Das Projekt prüft, wie unter diesen Bedingungen die Mentor-Qualifizierung gestaltet werden kann, um die praktisch tätigen Therapeuten auf die Arbeit mit Lernenden vorzubereiten und deren diesbezügliche Motivation zu fördern.
Studiengang: Interprofessionelle Gesundheitsversorgung I Ansprechpartnerin: Prof. Dr. Claudia Winkelmann
Einfluss des GeriNeTrainer-Programms bei multimorbiden, älteren PatientInnen rekrutiert aus Praxen mit geriatrischem Schwerpunkt
Gemeinsam mit ärztlichen und sozialwissenschaftlichen Kolleginnen hat Prof. Dr. Claudia Winkelmann im GeriNet Leipzig die Wirksamkeit eines speziell entwickelten Kognitions- und Trainingsprogramms (GeriNeTrainer) für hochbetagte, multimorbide Menschen untersucht. Ziel ist es, die flächendeckende Versorgung im Quartier zu stärken.
Studiengang: Interprofessionelle Gesundheitsversorgung I Ansprechpartnerin: Prof. Dr. Claudia Winkelmann
DIKOMED BW – Digitalkompetenz für medizinische Leistungserbringer
Das Forschungsprojekt DIKOMED BW fokussiert die DigitalKompetenz bei Medizinischen Leistungserbringern, insbesondere bei Ärzteschaft und Pflege in Baden-Württemberg. Gefördert durch das Land Baden-Württemberg aus dem Europäischen Sozialfond im Rahmen des Programms REACT-EU, E 1.1.3 Digitale Befähigung in Medizin und Akutpflege. Konsortialführer: Prof. Dr. Oliver G. Opitz, Leiter der Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg (KTBW). Die Forschungsgruppe an der DHBW Heidenheim unter der Leitung von Prof. Dr. Barbara Steiner & Prof. Dr. Marcel Sailer entwickelt dabei Digital Health & Education Trainings mit den Zielgruppen akademischer und nichtakademischer Pflegekräfte sowie Gesundheitssozialarbeiter*innen in der Anwendung technologischer Unterstützungssysteme (AAL Technologien) in der Gesundheitsversorgung. Das interprofessionell angelegte Projekt ist über das Innovationszentrum AAL InnoZ an die Hochschule angebunden.
Kontakt: Prof. Dr. Barbara Steiner, Prof. Dr. Marcel Sailer



Herausforderung der Sozialen Arbeit, die während der Coronakrise sichtbar wurden
Die DHBW Heidenheim und die University of Haifa erforschen gemeinsam, wie die Soziale Arbeit von der Coronakrise beeinflusst wurde. 17 Studierende der beiden Universitäten werden zusammen unter der Leitung von Professorin Dikla Segel-Karpas, Ph.D., Faculty of Social Welfare & Health Sciences, University of Haifa, und Prof. Dr. Roman Grinblat, LL.M, Professor in der Studienrichtung Sozialmanagement, DHBW Heidenheim, an verschiedenen Fragestellungen zum Thema „Social Work in Corona / post Corona Times“ arbeiten. Unter anderem wird analysiert, wie sich die Soziale Arbeit während Corona mit älteren Menschen, aber auch mit Jugendlichen verändert hat. Wie Digitalisierung Abhilfe schaffen und wie beispielsweise künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen kann, sind weitere Themen. Außerdem wird evaluiert, welche Rolle nachhaltige Finanzierung und private Investoren in der Sozialwirtschaft spielen. Das Projekt wird vom Generalkonsulat des Staates Israel und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg unterstützt.
Kontakt: Prof. Dr. Roman Grinblat, LL.M
Gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
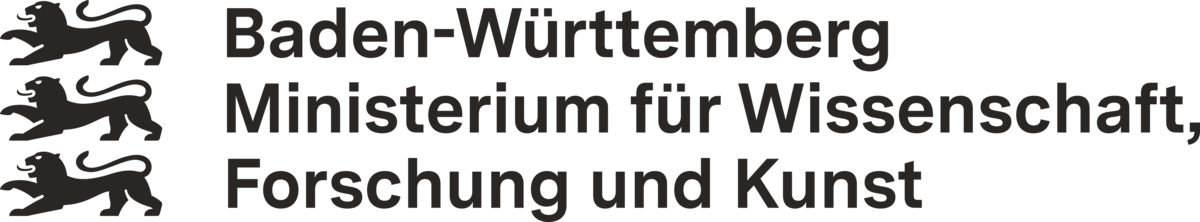
Wissenschaftliche Begleitung der Landesstrategie "Quartier2020 - Gemeinsam. Gestalten."
Wie sieht die Quartierslandschaft in Baden-Württemberg konkret aus? Mit dieser Frage beschäftigen sich Prof. Dr. René Gründer von der DHBW Heidenheim, Prof. Dr. Anja Teubert und Prof. Dr. Süleyman Gögercin von der DHBW Villingen-Schwenningen sowie die beiden Projektmitarbeiter Georg Reiff und Lisa Wabersich bis Dezember 2019. Als Quartier wird dabei ein lebendiger sozialer Raum verstanden, in dem sich Menschen einbringen, Verantwortung übernehmen und sich gegenseitig unterstützen. Dies können sowohl Straßenzüge als auch Nachbarschaften, Stadtteile oder ganze Dörfer sein.
Ziel ist es, flächendeckend und systematisch Strategien zur kommunalen Daseinsvorsorge auf der Ebene von lokalen, nachbarschaftlichen Wohngebietsstrukturen (Quartieren) in Baden-Württemberg zu untersuchen. Konkret werden dazu im ersten Schritt die Kommunen nach ihren aktuellen Aktivitäten befragt.
Beauftragt wurde das Projektteam vom Land Baden-Württemberg, Ministerium für Soziales und Integration im Rahmen der Landesstrategie "Quartier 2020 - Gemeinsam. Gestalten."
Kontakt: Prof. Dr. René Gründer I Studienrichtung: Soziale Arbeit
Zum Forschungsposter
Abschlussbericht Langversion (pdf)
Engagement fällt nicht vom Himmel. Qualifizierung von bürgerschaftlich Engagierten und Fachkräften in Baden-Württemberg
Bei Qualifizierungsangeboten für das Bürgerschaftliche Engagement (BE) steht nicht nur die inhaltliche Fortbildung im Fokus des Interesses. Qualifizierungs-möglichkeiten stellen für die Freiwilligen auch eine wichtige Form der Anerkennung und Aufwertung ihrer Tätigkeit dar. Das Projekt hat das Ziel, die bestehenden Qualifizierungsinstrumente auf ihre Passgenauigkeit für die Nutzer/-innen (Engagierte und BE-Fachkräfte) zu untersuchen und ggf. neue Qualifizierungsmöglichkeiten und -formate zu entwickeln.
Studienrichtung: Soziale Arbeit mit älteren Menschen/Bürgerschaftliches Engagement I Ansprechpartnerin: Prof. Dr. Andrea Helmer-Denzel
Zum Forschungsposter
Weiblich. Migriert. Engagiert. Freiwilliges Engagement von Frauen mit Zuwanderungsgeschichte
Freiwillig Engagierte sind „multimotiviert“. Es gibt nicht die eine Handlungslogik oder die einzelne Motivation. Jedes Individuum kann von einer Vielzahl von Beweggründen geleitet werden. Auch wenn die Motivation zwischenzeitlich einen großen Raum in der Engagementforschung einnimmt, bleiben spezielle Motive von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte weit-gehend unberücksichtigt. Meist wird auf Ergebnisse des Freiwilligensurveys Bezug genommen und somit auf Fragen, die Migrationsverhältnisse nicht speziell in den Blick nehmen. In der hier vorliegenden Studie wurden daher folgende Forschungsfragen gestellt: Gibt es spezielle Motive, die sich auf die Migrationserfahrung zurückführen lassen und die bislang in den Befragungen der Gesamtbevölkerung nicht erfasst werden? Gibt es Motive, die sich auf die Zuschreibung als „Mensch mit Migrationshintergrund“ zurückführen lassen? Gibt es spezielle Motive, sich in einem aufnahmelandbezogenen und nicht in einem eigenethnischen Verein zu engagieren?
Studienrichtung: Soziale Arbeit mit älteren Menschen/Bürgerschaftliches Engagement
Ansprechpersonen: Anne-Kathrin Schührer und Prof. Dr. Andrea Helmer-Denzel
Positionierung sozialstaatlicher Organisationen im institutionellen Feld
Die bisherige Forschung stellt eine Ökonomisierung sozialstaatlicher Organisationen fest. Die These, dass wirtschaftliche Werte primär handlungsleitend sind, wird mit Hilfe eines geeigneten Forschungsdesigns überprüft. Im Gegensatz zu bisherigen quantitativen Erhebungen verbleibt die Untersuchung nicht an der Oberfläche von formalen Regelungen. Außerdem wird eine vergleichende Perspektive eingenommen, die der Verschiedenartigkeit sozialstaatlicher Organisationen Rechnung trägt.
Studienrichtung: Soziale Dienste der Jugend-, Sozial- und Familienhilfe
Ansprechpersonen: Christine Dukek und Prof. Dr. Jürgen Burmeister
EU-Kooperationsprojekt zur “Kommunalen Konfliktberatung”
Die DHBW Heidenheim kooperiert mit dem forumZFD im Rahmen des Projekts "Kommunale Konfliktberatung: Partizipative Wege zur nachhaltigen Integration". Kommunen und Landkreise in Deutschland stehen angesichts von gesellschaftlichem Wandel in der aufnehmenden Gesellschaft und Migration vor großen Herausforderungen. Um die Integration von Drittstaatsangehörigen zu verbessern und die Vernetzung und Zusammenarbeit in Kommunen zu fördern, setzt das Projekt in verschiedenen Handlungsfeldern an, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union gefördert.
Studienrichtung: Kinder- und Jugendhilfe
Ansprechpersonen: Sylvia Lustig und Prof. Dr. Peter K. Warndorf
Dialogförderung Polizei - Fußballfans
Der 1. FC Heidenheim 1846 und die DHBW Heidenheim wollen in dem Kooperationsprojekt DiPoFu, gefördert von der Deutschen Fußballliga (DFL), gemeinsam mit der Polizei und den Fans sowie der Sozialen Arbeit als Vermittler neue Wege für ein sicheres Stadionerlebnis finden.
Studienrichtung: Kinder- und Jugendhilfe I Ansprechpartner: Prof. Dr. Peter K. Warndorf
Gemeinsam handeln: Prävention im ländlichen Raum
Soziale Arbeit hat die Aufgabe, Menschen mit Schwierigkeiten zu unterstützen. Dazu sind Angebote vor Ort erforderlich, die auch diese Zielgruppen ansprechen. Über Medienworkshops werden vor allem junge Menschen auf einem anderen Weg gewonnen und erhalten über die erstellten Filme die Möglichkeit, sich öffentlich zu positionieren.
Studienrichtung: Kinder- und Jugendhilfe I Ansprechpartner: Prof. Dr. Peter K. Warndorf
Lebensqualität älterer Menschen im ländlichen Raum
In Kooperation mit der Seniorenplanung des Landkreises Schwäbisch Hall wurden im Projekt "Alt werden im Landkreis Schwäbisch Hall" die Lebensbedingungen älterer Menschen und deren wesentliche Einflussfaktoren im ländlichen Raum in ausgewählten Kommunen erforscht. Dabei wurden in enger Abstimmung mit Verwaltung und Bürgermeister/-innen jeweils sozialraumbezogener Fragestellung mit geeigneten Methoden qualitativer und quantitativer Sozialforschung untersucht und die Ergebnisse in studentischen Lehrforschungsprojekten sichergestellt.
Studiengang: Soziale Arbeit I Ansprechpartner: Prof. Dr. René Gründer
Quartiersentwicklung Heidenheim ‘Zanger Berg’
Die Stadtrandsiedlung Heidenheim-Zanger Berg gilt aufgrund ungünstiger sozialer Durchmischung in Folge residentieller Segregationsprozessen als historisch gewachsener‚ sozialer Brennpunkt. Auf der Grundlage von Sozialraumanalyse, Begehungen, Einwohnerbefragungen und Bürgerbeteiligungsverfahren (Zukunftswerkstatt) werden Strategien und konkrete Projektideen für eine nachhaltige gemeinwesenorientierte Quartiersentwicklung entworfen.
Studiengang: Soziale Arbeit I Ansprechpartner: Prof. Dr. René Gründer
eCampus: Modul Recht II - Arbeitsrecht
In diesem eCampus-Projekt wurde im Zeitraum von 2015 - 2017 standortübergreifend eine Pilot-Lehrveranstaltung zum Thema Arbeitsrecht konzipiert. Diese bezieht virtuelle bzw. digital-integrierende didaktische Elemente ein und ist im Lernmanagementsystem Moodle abgebildet. Moodle dient u.a. als zentrale Sammelstelle für Lehrmaterialien („content sharing“), enthält interaktive Zusatzfunktionen (z.B. elektronische arbeitsrechtliche Fallstudien) oder ermöglicht den Zugang zu Online-Sprechstunden mit den Lehrbeauftragten.
Eigens für das Projekt wurde ein Lehrfilm "Der Kündigungsschutzprozess im Praxistest - DHBW eCampus" und Erklärvideos von Studierenden produziert.
Studiengang: BWL - Dienstleistungsmarketing I Ansprechpartner: Prof. Dr. Klaus Sakowski
RoTemp4.0
Gleichstrommotoren in Windenergieanlagen sind sicherheitsrelevante Systeme, weil sie zur Abschaltung benötigt werden. Ihre häufigste Ausfallursache ist Rotorüberhitzung. Im Projekt soll ein resilientes Verfahren zur Überwachung der Rotortemperatur entwickelt werden, das aus einem kostengünstigen Messsystem und einem prädiktiven Modell zur Vorhersage von Temperaturspitzen besteht.
Im Teilprojekt der Firma Ruckh wird das Messsystem entwickelt. Es ist vorgesehen, im Motor verbaute Spulen neben ihrer Antriebsfunktion zusätzlich als Widerstandsthermometer zu verwenden. Dazu soll der momentane Widerstand der Motorspulen idealerweise direkt im Laststrom über die regulären Schleifkontakte (Kohlebürsten am Kommutator) des Antriebes ermittelt werden. Gegebenenfalls sind zusätzliche Messabnehmer, ein zusätzlicher Messkollektor mit Schleifring oder spezialisierte Messspulen aus geeignetem Material in den Rotor einzubringen.
Im Teilprojekt der DHBW soll ein Beobachter/Filter mit einem thermischen Modell des Motors entwickelt werden, der aus dem aufgezeichneten Lastkollektiv die Temperaturspitzen berechnen und prognostizieren kann, um vorbeugend geeignete Schutzmaßnahmen zu aktivieren.
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Rupp
Die DHBW Heidenheim hat zusammen mit der Firma Ruckh einen Antrag beim Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gestellt und für das 24-monatige Projekt RoTemp4.0 eine Förderzusage erhalten.
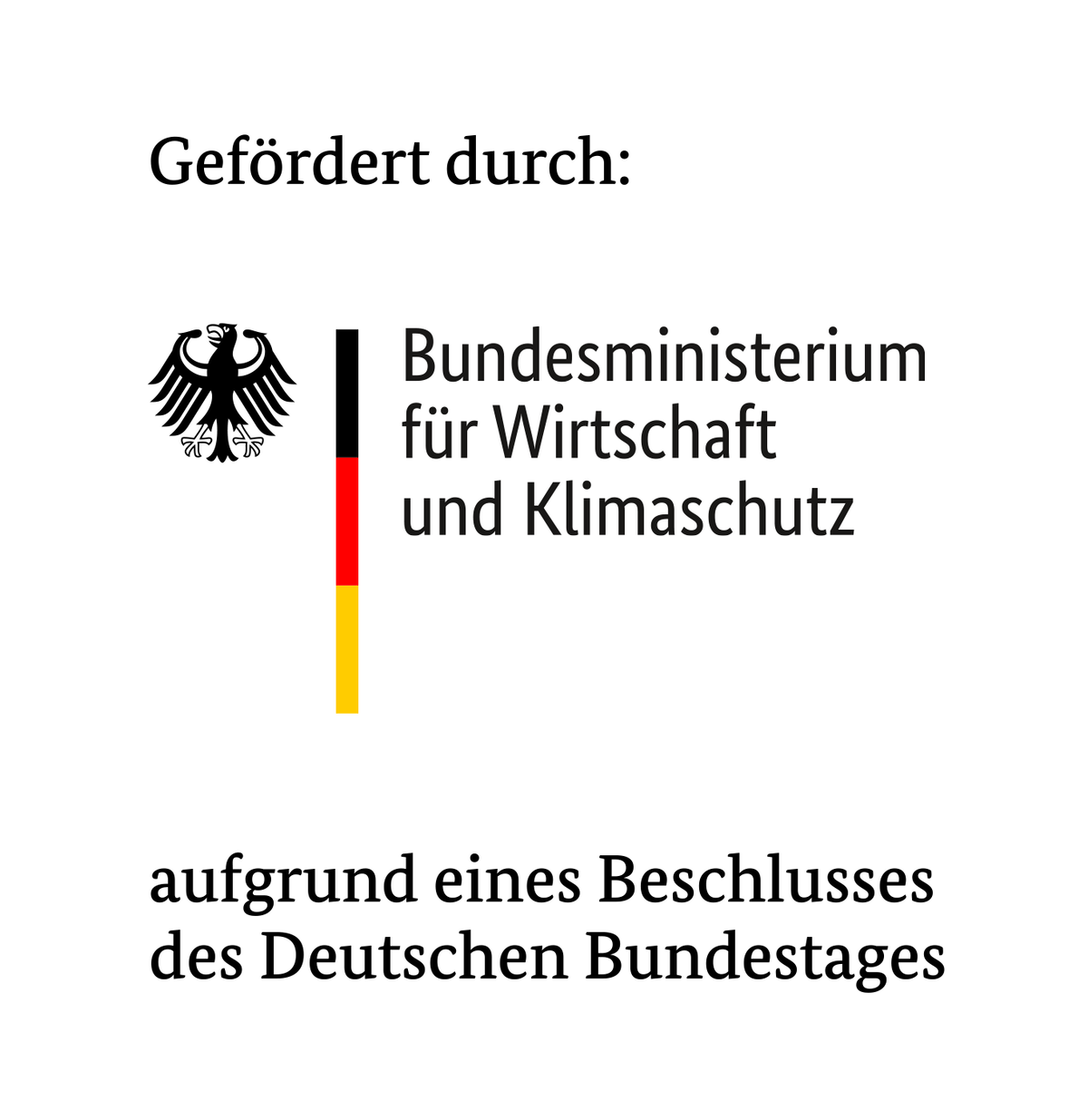
YardManagementHDH - Intelligente Yard-Logistik mit 5G
YardManagementHDH gestaltet die Zukunft von unternehmensinternen Logistikprozessen. Dafür muss die gesamte Logistik auf dem Gelände der BSH Giengen betrachtet und modernste Mobilfunktechnik eingesetzt werden. Konkretes Ziel des Projekts: Teleoperierte Transporte im Regelbetrieb auf dem Gelände von BSH Hausgeräte im Landkreis Heidenheim (HDH). Das Projekt wird im Rahmen der Bundesförderung „5G-Innovationswettbewerb“ vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr bis 2024 mit 3,9 Millionen Euro unterstützt.
Die DHBW Heidenheim übernimmt folgende Aufgaben des Projekts:
- Erfassung und Bewertung der wirtschaftlichen Betrachtung des Gesamtsystems unter Berücksichtigung u. a. der Kosten für autonome Fahrzeuge, der Infrastruktur wie etwa ein 5G-Netz.
- Entwicklung einer technischen Absicherung der Lagertore für Fahrzeuge, die nicht vollautonom fahren können oder nicht mit der notwendigen Sensorik ausgestattet sind.
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Rainer Kiesel
Zur Projektseite
Zum Abschlussbericht
DHBW Förderlinie (MWK): Entwicklung neuartiger, integrierter Vapor-Chambers zur Kühlung von Proton Exchange Membrane (PEM) Brennstoffzellen mittels additiver Fertigung
PEM-Brennstoffzellen, in denen durch die elektrochemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff Strom und Wärme erzeugt wird, haben das Potential einen signifikanten Beitrag zur Energiewende zu leisten. Bei den Komponenten eines Brennstoffzellensystems spielt das Kühlsystem eine entscheidende Rolle. Vor diesem Hintergrund werden im vorliegenden Projekt mittels additiver Fertigung (" Metall-3D-Druck") neuartige Vapor-Chambers entwickelt, die vollständig in die Bipolarplatte der Brennstoffzelle integriert sind. Im Ziel erwarten wir eine deutlich effizientere und homogenere Kühlung, welche die Lebensdauer der Brennstoffzelle deutlich erhöht.
Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Nico Blessing und Stephan Stötter
Gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
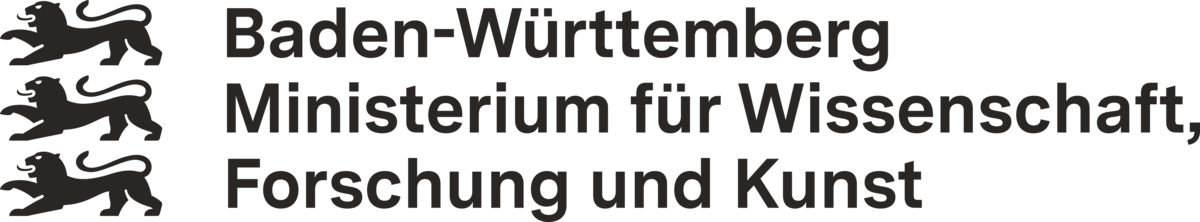
ZIM-Projekt DARC 1000 - High Tech meets High End
Um eine möglichst perfekte Illusion des Geschehens auf einer akustischen Bühne zu erhalten, muss insbesondere die Aufstellung und Ausrichtung von Lautsprechern an den Raum, in dem gehört werden soll, angepasst werden. Hierzu sind komplexe Messungen und Berechnungen nötig. In diesem Umfeld war das ZIM-Projekt „Passiv-Lautsprecherbox mit selbsttätiger akustischer Optimierung durch elektrische Positionierung der Mittel-Hochtoneinheit mit Hilfe eines automatisierten tabletgestützten Messsystems – DARC 1000“ angesiedelt, das die DHBW Heidenheim (vertreten durch die Prof. Till Hänisch und Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Rupp) gemeinsam mit Gauder Akustik in Renningen in den vergangenen zwei Jahren durchführte. Wie bestimmt man algorithmisch die beste Positionierung in einem Raum, den man nicht kennt? Und wie richtet man die Lautsprecher dann am besten aus? Die Beantwortung dieser Fragen erforderte umfangreiche Messungen und Simulationen. Dazu mussten zunächst grundlegende Untersuchungen über die Interaktion zwischen Lautsprecher und Raum durchgeführt werden. In Simulationen wurden die Erkenntnisse auf die technischen Möglichkeiten umgesetzt. Hierzu waren Entwicklungen sowohl im Bereich der Mechanik, Antriebstechnik, Sensorik und Programmierung nötig. Während in der Entwicklung spezielle – und teure – Mess- und Simulationstechnik eingesetzt werden musste, gelang die Realisierung auf der Basis eines Smartphones und Standardkomponenten aus dem industriellen Bereich. Dr. Roland Gauder zum Projekt: „Die Zusammenarbeit mit der DHBW Heidenheim war für uns eine unschätzbare Hilfe in vielen Bereichen von Mechanik, Antriebstechnik, intelligenter Steuerung als auch Prozessdatenauswertung und Programmieren von intelligenten Algorithmen, die nachher die Klangqualität der Lautsprecher enorm verbessern können. Nach wie vor gilt, dass die Raumakustik des Wiedergaberaums mit Abstand den größten klanglichen Einfluss hat. Durch die Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Hänisch und Herrn Prof. Rupp und deren Mitarbeitern konnten wir so ein Produkt realisieren, das wir alleine und in dieser perfekten Art und Weise niemals hätten entwickeln und bauen können.“
Kontakt: Prof. Till Hänisch und Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dieter Rupp
Smart Vehicle
Im Rahmen der Forschungskooperation zwischen dem „Indian Institute for Information Technology (IIIT)“ und dem Studiengang Informatik der DHBW Heidenheim soll eine Software-Lösung entwickelt werden, die das Verhalten eines Autofahrers in typischen Verkehrssituationen qualitativ bewerten kann. Um überhaupt Datenmaterial zu haben, wurden in speziell präparierten Autos Eye-Tracking-Experimente durchgeführt und es konnten Aufzeichnungen zu Blickführung und der fahrerseitig erlebten Verkehrssituation gemacht werden. Dr. Hrishikesh Venkataraman (IIIT) und Prof. Dr. Rolf Assfalg (DHBW Heidenheim) erwarten, dass sich aus diesen Daten Regeln ableiten lassen, auf welche Aspekte ein Fahrer in einzelnen Situationen seine Aufmerksamkeit verteilt. Dadurch könnte eine Art Standardverhalten von Autofahrern beschrieben werden, mit denen später das Fahrerverhalten von Menschen automatisch bewertet werden könnte. Für das Projekt konnte die DHBW Mittel für die anfallenden Mobilitätskosten beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) einwerben.
Studiengang: Informatik I Laufzeit: 2016 - 2017 I Ansprechpartner: Prof. Dr. Rolf Assfalg
Zum Forschungsposter
Funktionale Programmierung für das Internet der Dinge
Komponenten des Internet der Dinge (IoT) wie etwa Lichtschalter, Thermostaten oder andere Sensoren und Aktoren sind besonders empfindlich gegenüber Softwarefehlern. Kleinere Fehlfunktionen können vielleicht noch hingenommen werden, aber Software-Bugs können zu Sicherheitslücken führen, die hier nicht akzeptabel sind, da die reale Welt geschädigt wird.
Studiengang: Wirtschaftsinformatik I Ansprechpartner: Prof. Till Hänisch
Energieoptimierung von Papiermaschinen durch Sensornetze
Drahtlos angebundene Sensoren lassen mit geringem Aufwand flexible Langzeitmessungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Trockenpartie von Papiermaschinen zu. Dadurch kann die Trockenpartie insgesamt „kritischer“, also näher am Auslegungspunkt betrieben werden. Bei ersten Experimenten konnte eine Einsparung von 80.000 € jährlich an einer einzigen Maschine realisiert werden.
Studiengang: Wirtschaftsinformatik I Ansprechpartner: Prof. Till Hänisch
Online-Verschleißbeurteilung von Formiersieben
Mit einem schnellen LED-Blitzgerät werden Aufnahmen von Formiersieben in Papiermaschinen im laufenden Betrieb gemacht. Das ist aus mehreren Gründen nicht einfach. Deshalb wurde ein geeigneter LED-Blitz entwickelt und unter Produktionsbedingungen über mehrere Wochen getestet.
Studiengang: Wirtschaftsinformatik I Ansprechpartner: Prof. Till Hänisch
Ansprechpersonen
Bei Fragen zu den Forschungsprojekten oder bei Forschungsanliegen allgemein wenden Sie sich bitte an:
Folger, Mirjam, Dr.
Leiterin Forschung, Innovation und Transfer
Ansprechpartnerin Projekt StartUpSÜD
Hanns-Voith-Campus 1, Raum B2.02, 89518 Heidenheim

Forschungsanfragen
Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Dualen Partnern verknüpft die DHBW Heidenheim als einzige Hochschule wissenschaftliches Know-how mit Wissen um Fragestellungen in Unternehmen und ganzen Branchen. In Form einer Kooperation können Forschungspartner Erkenntnisse der Grundlagenforschung sowie DHBW-eigene Forschungsergebnisse nutzen und so bedarfsorientierte Lösungen für betriebliche Fragestellungen finden.
Forschungsaktivitäten können in verschiedenen Kooperationsformen durchgeführt werden:
- Geförderte Kooperationsprojekte
- Kooperative wissenschaftliche Arbeiten und Forschung
- Auftragsforschung.
Falls Sie an einer Kooperation interessiert sind, füllen Sie gerne unten stehendes Formular aus.
Weitere Informationen
- Forschung an der DHBW Mit der Umwandlung zur Hochschule hat die DHBW einen Forschungsauftrag erhalten. Dem Prinzip der Dualität entsprechend erfolgt Forschung anwendungs- und transferorientiert, vor allem in Kooperation mit den Dualen Partnern.
- Labore an der DHBW Heidenheim Die DHBW Heidenheim verfügt über verschiedene Labore, die einerseits die Lehre, aber auch Forschung, Innovation und Transfer unterstützen.
